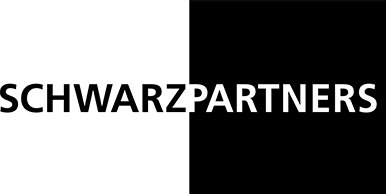Inhalt
Das Aktuelle für Ärzte & Heilberufe - Ausgabe 2/21
Atemstillstand im Aufwachwraum: wer ist verantwortlich zu machen?
Die Frage über die Verantwortlichkeit eines operierenden Hals-Nasen-Ohren-Arztes (HNO), in dessen Praxis ein Kind nach einer Nasenoperation im Aufwachraum verstarb, konnte im folgenden Fall nach voriger Verurteilung der verantwortlichen Narkoseärztin erst das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) beantworten.
Ein neunjähriges Kind unterzog sich einer Operation zur Verbesserung der Nasenatmung in der Praxis eines niedergelassenen HNO-Arztes. Zur Durchführung der Narkose war eine Anästhesistin anwesend. Die vom HNO-Arzt durchgeführte Operation verlief als solche völlig komplikationslos.
Nach der Operation wurde das Kind, das noch nicht aufgewacht war, in einen Aufwachraum gebracht. Dort wartete bereits sein Vater, der in der Folgezeit bei dem Kind blieb.
Nach kurzer Zeit machte der Vater den HNO-Arzt darauf aufmerksam, dass das Kind nicht mehr atme. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlitt das Kind aufgrund mangelnder Sauerstoffversorgung schwere Hirnschädigungen, an deren Folgen es eine Woche später verstarb.
Die Anästhesistin wurde wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie keine ordnungsgemäße kontinuierliche Überwachung der Sauerstoffsättigung während der Aufwachphase des Kindes sichergestellt hatte. So seien - entgegen dem anästhesiologischen Standard - im Aufwachraum keine Pulsoxymeter mehr vorhanden gewesen.
Das gegen den operierenden HNO-Arzt und Praxisinhaber eingeleitete Strafverfahren wurde hingegen eingestellt. Die Kindesmutter strebte jedoch auch dessen Verurteilung wegen billigender Inkaufnahme einer mangelhaften Praxisorganisation an - vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht (OLG) ohne Erfolg.
Doch das BverfG sah den Sachverhalt ganz anders. Das OLG hätte sich auch mit einer den HNO-Arzt selbst treffenden Aufklärungspflicht bezüglich der mangelhaften Überwachung im Aufwachraum auseinandersetzen müssen. Das Gericht habe in diesem Zusammenhang wesentliche Aspekte der zur Verfügung stehenden Beweismittel (dem Praxisinhaber waren die organisatorischen Missstände seit Jahren bekannt) unberücksichtigt gelassen.
Ein von mehreren Personen durchgeführter medizinischer Eingriff stelle regelmäßig mehr dar als die Summe voneinander getrennter ärztlicher Einzelleistungen. Gerade die Organisation der Zusammenarbeit sei trotz des Vertrauensgrundsatzes als notwendige Bedingung einer Zusammenarbeit ein wesentlicher Bestandteil der ärztlichen Sorgfaltspflichten.
Krankenhauseinweisung unterlassen: Niedergelassene Kinderärzte haften
Können niedergelassene Kinderärzte haftbar gemacht werden, wenn Patienten aufgrund unterlassener Krankenhauseinweisung Folgeschäden erleiden? Das musste das Oberlandesgericht Köln (OLG) entscheiden.
Im Urteilsfall verstießen gleich zwei Kinderärzte gegen ihre Pflichten, nachdem die Mutter mit ihrer Tochter (Klägerin) aufgrund fortdauernden wässrigen Durchfalls und Erbrechens an mehreren Tagen nacheinander - zuerst am 21.04.2003 - bei den entsprechenden Kinderärzten vorstellig wurde, zuletzt mit dem Hinweis, dass ihre Tochter nicht mehr trinke. Statt weitere Untersuchungen zu veranlassen oder den Säugling sofort in ein Krankenhaus einzuweisen, wurde die Mutter mit Rezepten und teilweise direkt von Arzthelferinnen abgefertigt.
Die Vorstellung der Patientin in einem Krankenhaus hätte laut Sachverständigem dazu geführt, dass sie bei seit längerer Zeit andauerndem Brechdurchfall unter ärztlicher Kontrolle des Krankenhauses und der dort tätigen Ärzte - stationär oder ambulant - geblieben wäre. Dadurch wäre eine sich entwickelnde hypertone Dehydratation rechtzeitig behandelt worden. Lehnt ein Patient eine ihm angeratene Behandlung (z.B. Krankenhauseinweisung) ab, hat ihn der Arzt in einer für den Patienten verständlichen Art und Weise über die Notwendigkeit der Behandlung aufzuklären. Dies gilt vor allem für die Folgen der Unterlassung der Behandlung.
Der Hinweis der zweiten Kinderärztin, es drohe eine Verschiebung der Salze, die nicht mit dem Leben vereinbar sei, sei hier nicht ausreichend gewesen, um den Eltern der Patientin die Dringlichkeit einer weiteren Behandlung zu verdeutlichen. Die Behandlungsfehler seien für den am 25.04.2003 festgestellten Eintritt einer schwersten hypertonen Dehydratation/Toxikose ursächlich geworden. Das OLG machte deshalb beide Kinderärzte als Gesamtschuldner wegen des nachfolgend eingetretenen Gehirnschadens des Säuglings haftbar.
Hinweis: Bei unklarer Herkunft der Beschwerden eines Kleinkindes hat der Kinderarzt entweder weitere diagnostische Mittel einzusetzen oder das Kleinkind zeitnah in ein Krankenhaus einzuweisen. Kinderärzte sollten ihr Praxispersonal klar anweisen, in Fällen unklarer und fortdauernder Beschwerden eines Kleinkindes das Kind erneut dem Arzt vorzustellen. Dabei hat dieser den Eltern die Notwendigkeit einer Krankenhausbehandlung in verständlicher Weise zu verdeutlichen. Zudem sollte die Belehrung dokumentiert werden.
Befunderhebungsfehler: 50.000 € Schmerzensgeld für 70-Jährige
Wie hoch kann das Schmerzensgeld nach einem Befund-erhebungsfehler, im Urteilsfall einem zu spät erkannten Tumor, ausfallen und nach welchen Kriterien berechnet es sich? Darüber musste das Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) im nachfolgenden Fall entscheiden.
Der Kläger im Urteilsfall machte für seine verstorbene Ehefrau Schmerzensgeld gegen den behandelnden Arzt geltend. Die Patientin war im Herbst 2010 wegen undefinierbarer Schmerzen in einem bereits geschwollenen rechten Oberschenkel in die orthopädische Fachpraxis des Beklagten überwiesen worden. Dort wurde im Oktober lediglich ein Hämatom diagnostiziert. Erst Ende November veranlasste der Beklagte eine MRT-Untersuchung. Dabei wurde ein Tumor diagnostiziert, der im Dezember reseziert wurde. Nachdem bereits im Februar 2011 eine Metastase gefunden worden war, konnte der Krebs nicht mehr eingedämmt werden. Die Patientin verstarb im
August 2012.
Das Landgericht hatte zunächst ein Schmerzensgeld von 30.000 € zugesprochen. Das OLG verurteilte den Beklagten in der hiergegen eingelegten Berufung zur Zahlung eines Schmerzensgeldes von 50.000 €. Der Beklagte hafte für die durch sein Fehlverhalten entstandenen Schäden, da er die Erhebung medizinisch gebotener Befunde unterlassen habe. Der Tumor hätte gemäß den Angaben des Sachverständigen bereits Ende Oktober erkannt werden können.
Bei einer um einen Monat früheren Diagnose wäre die statistische Prognose der Patientin besser gewesen. Aufgrund des vom Kläger dargestellten Leidenswegs seiner Frau sowie unter Berücksichtigung ihres Alters und ihrer Lebensumstände sei ein Schmerzensgeld in Höhe von 50.000 € angemessen.
Hinweis: Verstirbt ein betagterer Patient (hier: eine 70-jährige Patientin) an einer zu spät erkannten Krebserkrankung, sind für die Bemessung des Schmerzensgeldes einerseits der Leidensweg maßgeblich (Heftigkeit und Dauer der Schmerzen). Andererseits sind auch das Alter und die familiäre Situation, die Rückschlüsse auf die erlittenen Lebensbeeinträchtigungen zulassen, zu berücksichtigen.
Entstellung nach Operation: Muss Krankenkasse Kosten übernehmen?
Mit der Frage, ob eine gesetzliche Krankenversicherung dazu verpflichtet ist, die Kosten für eine beidseitige Oberarmstraffung zu übernehmen, wenn eine Entstellung nach vorausgegangener Operation vorliegt, musste sich das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen (LSG) im folgenden Fall beschäftigen.
Nach einer Schlauchmagenoperation verlor eine gesetzlich krankenversicherte Frau 45 bis 50 kg an Gewicht. Dadurch bedingt kam es zu einem Fettverteilungstyp mit massivem Hautüberschuss an beiden Oberarmen. Trotz unauffälliger, lockerer Alltagskleidung war eine massive Asymmetrie des Erscheinungsbildes von Ober- und Unterarm sichtbar. Die Frau beantragte daher im März 2011 bei ihrer Krankenkasse die Übernahme der Kosten für eine beidseitige Oberarmstraffung. Diese lehnte die Krankenkasse jedoch ab, sodass die Frau Klage erhob.
Das Sozialgericht Braunschweig (SG) gab der Klage allerdings nicht statt. Dagegen richtete sich die Berufung der Klägerin. Das LSG entschied schließlich zugunsten der Klägerin und hob daher die Entscheidung des SG auf. Der Klägerin stehe der Anspruch auf die Übernahme der Kosten für die beidseitige Oberarmstraffung zu. Dieser ergebe sich aus der entstellenden Wirkung des Erscheinungsbildes der Oberarme.
Hinweis: Eine Entstellung liegt laut Gericht dann vor, wenn eine körperliche Auffälligkeit in einer solchen Ausprägung vorhanden sei, dass sie sich schon bei flüchtiger Bewegung in alltäglichen Situationen bemerkbar mache und regelmäßig zur Fixierung des Interesses anderer auf den Betroffenen führe. So lag der Fall hier.
Ist der Heimvertrag mit verhaltens-auffälligen Demenzkranken kündbar?
Ob der Heimvertrag mit Demenzpatienten aufgrund demenzbedingter Verhaltensauffälligkeiten gekündigt werden kann, musste das Oberlandesgericht Oldenburg (OLG) im folgenden Fall klären.
Seit 2015 lebte eine an Demenz erkrankte Frau in einem Seniorenheim mit eigener Demenzabteilung. Mit der Behauptung, die Frau störe mit ihrem Verhalten den Heimfrieden, kündigte die Heimbetreiberin im September 2018 den Heimvertrag mit der Frau aus wichtigem Grund: Die Frau laufe ständig umher und suche die anderen Bewohner in ihren Zimmern auf. Dies geschehe auch zur Nachtzeit. Sie betrete auch regelmäßig das Zimmer eines bestimmten Bewohners und schaue diesem gegen seinen Willen bei dessen Intimpflege zu. Zudem sei sie aggressiv, boxe Pflegekräfte und fahre Personen mit ihrem Rollator an.
Die Heimbetreiberin klagte schließlich auf Räumung und Herausgabe des bewohnten Zimmers. Das Landgericht Osnabrück wies die Klage ab, denn es liege kein wichtiger Grund zur Kündigung des Heimvertrags vor. Das behauptete Verhalten der Heimbewohnerin sei für die Heimbetreiberin zumutbar. Gegen diese Entscheidung legte die Heimbetreiberin Berufung ein. Das OLG bestätigte jedoch die Entscheidung der Vorinstanz.
Ein Recht zur Kündigung des Heimvertrags aus wichtigem Grund liege nicht vor, sodass der Räumungs- und He-rausgabeanspruch nicht bestehe. Angesichts dessen, dass der Heimbetreiberin die Demenzerkrankung der Bewohnerin bei deren Aufnahme bekannt war und die Bewohnerin in der Demenzabteilung lebte, sei der Heimbetreiberin ein Festhalten am Vertrag zumutbar. Gewisse Verhaltensauffälligkeiten von Demenzpatienten seien hinzunehmen. Das von der Heimbetreiberin behauptete Verhalten der Heimbewohnerin habe sich noch im Rahmen dessen bewegt, was von dem Betreiber eines Pflegeheims mit demenzkranken Bewohnern einer dem Heim angegliederten Demenzabteilung hingenommen werden müsse.
Hinweis: Wenn Heimbewohner eine erhebliche
Gefahr für sich und/oder andere darstellen und die Heimleitung belegen kann, dass anderen Bewohnern Sach- oder Körperschäden zugefügt werden, kann die Kündigung eines Heimvertrages begründet sein. In diesem Fall war das allerdings nicht gegeben.
Kein Corona-Test: Darf eine Klinik die Behandlung verweigern?
Inzwischen gibt es die erste für Krankenhäuser erfreuliche Gerichtsentscheidung, wonach sich Patienten vor Aufnahme in ein Krankenhaus einem Corona-Test unterziehen müssen. Bei Verweigerung kann die Aufnahme abgelehnt werden. Die Entscheidung ist im einstweiligen Rechtsschutzverfahren ergangen und ist rechtskräftig.
Zum Fall: Die sich in der 33. Schwangerschaftswoche befindliche Klägerin begab sich am 22.09.2020 wegen starker Schmerzen in der linken Niere in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Die behandelnde Ärztin empfahl die dringende urologische Abklärung in einem anderen Krankenhaus. Dort sollte sich die Patientin auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 testen lassen, was sie ablehnte, da es hierfür keine rechtliche Grundlage gebe. Sie musste daraufhin das Krankenhaus verlassen.
Die Patientin versuchte anschließend, das Krankenhaus im Wege der einstweiligen Verfügung dazu zu verpflichten, sie zu behandeln - und zwar ohne von ihr die Mitwirkung bzw. Hinnahme einer Untersuchung zur Feststellung einer Infektion mit SARS-CoV-2 zu verlangen. Sowohl das Amtsgericht Dortmund als auch das Landgericht Dortmund (LG) lehnten den Erlass der beantragten einstweiligen Verfügung ab.
Das Krankenhaus sei im konkreten Fall ohne vorherige Durchführung eines Corona-Tests nicht zur Aufnahme verpflichtet. Etwaige Nachteile aufgrund des Tests habe die Klägerin nicht darlegen können. Eine Eilbedürftigkeit folge auch nicht aus dem Umstand ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft. Zwar habe das Krankenhaus grundsätzlich - unabhängig von dem Versichertenstatus - eine Aufnahme- bzw. Behandlungspflicht. Diese bestehe aber nicht unbeschränkt.
Hinweis: Die Entscheidung bringt erfreuliche Klarheit für die Krankenhäuser, indem das Gericht in aller Deutlichkeit darauf hinweist, dass die abverlangte Testung rechtmäßig ist. Voraussetzungen dafür sind, dass es sich um einen vom RKI anerkannten Test handelt und dass das Krankenhaus in jeder Hinsicht nachvollziehbare und begründete Motive verfolgt, dem Schutz von Mitpatienten und Mitarbeitern vor einer möglichen Infektion und der Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebs zu dienen. Die Entscheidung des LG ist jedoch nur für elektive Krankenhausbehandlungen nutzbar, gilt also nicht bei Notfällen.
zurück zur Übersicht